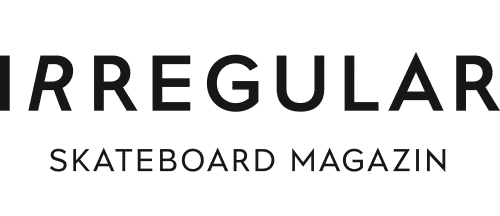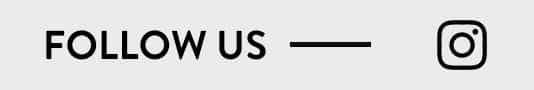Im Gespräch mit Conny Mirbach
ÜBER
FOTOGRAFIE
IM GESPRÄCH
MIT CONNY
MIRBACH
Fotos
Nikolas Tušl
—
Interview
Stefan Gottwald


ÜBER
FOTOGRAFIE
IM GESPRÄCH
MIT CONNY
MIRBACH
Fotos
Nikolas Tušl
—
Interview
Stefan Gottwald
Conny, schön, dass du Zeit hast. Der Klassiker zum Einstieg. Stell dich doch mal vor für die Leute, die dich nicht kennen. Hi, ich bin Conny Mirbach, 30 Jahre alt, lebe in München und bin durch das Skateboard Fahren zum Fotografieren gekommen. Da Skateboarding ein recht medialer Sport ist, ist immer irgendwo eine Kamera involviert. Das hat bei mir dazu geführt, dass das Thema irgendwann einmal interessant wurde und ich angefangen habe, selber Dinge festzuhalten, die beim Skateboard Fahren passieren.
Ging das bei dir dann klassisch los? Jeder kennt das: Man ist mit seinen Leuten am Street Skaten und einer fängt an, Bilder zu machen und das so lange, bis er der Fotograf der Crew ist. Ja, schon ein bisschen. Am Anfang war es aber eher so: Da ich schon seit Längerem immer ein bisschen gesponsert wurde, kam es häufiger vor, dass ich fotografiert wurde – unter anderem auch von Phil Pham, der für mich ein großer Einfluss war. Irgendwann einmal interessierte mich das gesamte Thema Fotografie und ich kaufte mir eine analoge Kamera. Statt aber das Skaten an sich zu fotografieren, lag mein Fokus damals eher auf allem, was so drum herum passiert. Ich war ein krasser Fan der Fotografen der amerikanischen Fotoagentur namens Magnum. Da waren so ikonische Figuren wie Elliott Erwitt oder Bruce Davidson dabei. Viele schwarz-weiß Fotografen, die auf einem unglaublich hohen Level dokumentarisch arbeiten. Davon habe ich mich ein bisschen beeinflussen lassen und auch viel nach alternativen Perspektiven gesucht. Darunter waren, zum Beispiel, Bilder, bei denen ein Trick zu sehen war, im Vordergrund aber etwas völlig anderes passierte.
Wir haben für dieses Interview deinen Instagram-Account zerpflückt und dabei ist aufgefallen, dass du drei Jahre lang ausschließlich schwarz-weiß Bilder gepostet hast. Wieso kam dann ein Cut? Der Cut kam, weil ich oft auf meine vermeintlichen Fotoarbeiten angesprochen wurde. Da spielt es jetzt auch überhaupt keine Rolle, ob die Leute meine Sachen gut oder schlecht fanden. Aber mir ist aufgefallen, dass viele Personen meine schwarz-weißen Handybilder für meine Arbeiten gehalten haben. Eigentlich habe ich aber nur jeden Tag irgendein Bild mit meinem Handy gemacht und das einfach hochgeladen. Damals war mein Account deutlich unmittelbarer, als er es jetzt ist, denn es waren Bilder, die ich den Tag über aufgeschnappt habe. Schwarz-weiß waren die Bilder nur, damit sie besser zusammenpassen und alles schön aussieht. Das hat sich nun etwas geändert, denn ich musste umswitchen und den Account zu meinem Arbeitsaccount machen. Schließlich besuchen mein Profil mittlerweile auch Personen, die mir eventuell auch mal einen Job geben möchten (lacht!). Deshalb sind die Bilder jetzt farbig.
Etwas Gedrucktes hat für mich einfach mehr Bestand


Ist Instagram eine Plattform, die für dich das Portfolio ersetzt? Einen Job habe ich tatsächlich noch nie über Instagram bekommen. Mittlerweile ist es aber in der professionellen Fotografie ein wichtiger Bestandteil geworden. Das liegt daran, dass die Bildredakteure, die dich buchen, als allererstes ihr Handy in der Hand haben und kurz bei Insta schauen, was der Fotograf denn so macht. Ich kann dort zeigen, was ich außerhalb des Skateboardens mache.
Ist es dir wichtig, deine Bilder gedruckt zu sehen oder freust du dich sogar mehr, wenn deine Bilder in einem Blog mit riesiger Reichweite geteilt werden? Das verschwimmt immer mehr. Oft wird ja beides gemacht: Dein Bild erscheint im Magazin und wird zeitgleich irgendwo ins Internet geladen. Trotzdem ist Print für mich immer noch das hochwertigere Medium. Das liegt vielleicht auch am Alter und dass ich etwas oldschool denke (lacht!). Etwas Gedrucktes hat für mich einfach mehr Bestand. Um etwas zu drucken, muss Geld in die Hand genommen werden. Das ist dann schon noch mal etwas anderes, als den Artikel oder das Bild einfach nur online auf irgendeinen Blog zu stellen.
Weißt du noch, wann und auch wo dein erstes Foto gedruckt wurde? Puh, schwierig! Ich weiß es noch bei meinem ersten Skatefoto, auf dem ich selbst zu sehen war. Das war ziemlich geil! Ein Kickflip Backside 5-0 an einem Curb, das wir auf einem Contest in Hamburg ein paar Stufen runtergestellt hatten. Das war sogar eine Sequenz im Bordstein-Magazin (lacht!). Von meinen Arbeiten erschien das erste Foto (überlegt) in der Süddeutsche Zeitung, beziehungsweise deren Jugendseite. Dort habe ich meine ersten Erfahrungen mit richtigen Jobs gemacht. Genau weiß ich das Motiv nicht mehr, aber es war ein Porträt von einem Künstler oder Musiker. In der Süddeutschen ein großes Bild zu haben, fand ich aber auf jeden Fall ziemlich cool.
Du hast ja Fotodesign studiert. Wieso eigentlich und was hast du aus dem Studium mitgenommen? Ja, für mich gab es damals zwei Möglichkeiten, etwas in diese Richtung zu machen. Da standen eine Ausbildung zum Fotografen oder eben ein Studium zur Auswahl. Für das Studium hatte ich mich entschieden, weil ich den Eindruck hatte, drüber mehr Einflüsse von verschiedenen Leuten zu bekommen. Wenn man eine Ausbildung macht, hat man am Ende einen Chef, also einen Fotografen, von dem du alles genauso lernst, wie er das macht. Beim Studium hast du verschiedene Dozenten und Kommilitonen, die einen beeinflussen und mit denen du dich austauschen kannst. Das war der Grund, weshalb ich lieber das Studium gewählt habe.
Hast du beim Fotografieren ein Standard-Equipment? Naja, ich mache das eigentlich von der Situation abhängig. Bei richtigen Jobs habe ich aber meistens meine Canon 5D dabei und wechsle meist nur zwischen einem 40 und einem 50 Millimeter Objektiv. Das sind zwar keine besonders spannenden Objektive, weil sie so ziemlich denselben Bereich abbilden, den das menschliche Auge erfasst, aber für mich funktioniert das irgendwie am besten. Ich arbeite wenig mit Effekten und finde daher verzerrende Weitwinkel meistens nicht so geil. Extrem unscharfe Hintergründe sind auch nicht so das meine, deshalb bin ich eher ein Freund von normalen Bildern, die aber trotzdem beispielsweise durch eine schöne Lichtstimmung funktionieren. Für persönliche Projekte schieße ich immer noch gern auf Film. Meistens nehme ich dafür die Contax G2 oder die T2.
Da Skateboarding ein recht medialer Sport ist, ist immer irgendwo eine Kamera involviert.


Der Ollie an der Schwabenlandhalle in Stuttgart von Chris Pfanner war ein riesen Ding und jeder, der dort mal skaten war hat sich die Frage gestellt, ob das Ding überhaupt machbar ist – bis zu deinem Foto! Erzähl uns doch mal ein bisschen über dieses 8er-flat-6er- Monster und der Story dahinter. Das war tatsächlich ziemlich absurd. Überhaupt die ganze Geschichte, wie es dazu kam. Chris rief mich irgendwann einmal an, weil er ein Foto von mir gesehen hatte, welches ich von Tommy Brandelik an so einem absurd großen 13er Rail in München geschossen hatte. Darauf macht Tommy einen Frontboard und Chris wollte das Rail auch gerne skaten. Er meinte, es wäre nur fair, wenn ich das Bild schießen würde, da er ja über mich auf den Spot gekommen sei. Das fand ich extrem cool von ihm. Richtig geiler Typ! Wir fotografierten einen Tag lang in München und checkten eben auch das Rail ab. Einige Zeit nach dieser Session verabredeten wir uns nochmal in Stuttgart. Damals wohnte Adri Kuchenreuther noch dort, der als Filmer dabei sein sollte. Wir fuhren dann zusammen an verschiedene Spots und eigentlich wollte Chris so ein mega großes Rail an der Schwabenlandhalle fahren. Vor dem Rail standen so riesige Blumenkästen und außerdem fühlte Chris den Spot auch nicht so richtig. Als Adri und ich dann auf den Stufen saßen und überlegen, wo wir sonst hinfahren könnten, hörten wir auf einmal ein übertriebenes Anpush-Geräusch und plötzlich flog dieser Typ (Chris) neben uns die Treppen runter. Das Witzige war, dass wir die Stufen gar nicht als Spot wahrgenommen hatten. Das war richtig schräg, denn wir hatten noch kein bisschen darüber geredet, dieses Doubleset in Szene zu setzen. Dazu kam, dass der erste Versuch von Chris sogar ganz gut war und deshalb beschlossen wir, ihn zu machen. So ist dieser Ollie entstanden. Das war echt krass (lacht!) und einfach mega absurd!
Durch das ganze durch die Straßen Gepushe lernt man ja viele Spots kennen. Nutzt du diese Orte auch für andere Jobs außerhalb des Skateboardens? Tatsächlich hatte ich noch vor diesem Interview so eine Situation. Ich sollte an einer Schule in Neukeferloh, einem Kaff am Arsch der Welt, etwas fotografieren. Diese Schule hat aber so eine Bank to Wall auf dem Schulhof, weshalb ich früher schon mal zum Skaten dort war. Ich konnte somit die Redakteurin, mit der ich unterwegs war, direkt dorthin führen. Das ist total lustig, weil ich den Ort durch einen völlig anderen Kontext kennengelernt hatte. Irgendwann vor Jahren kletterten wir mal über den Zaun, um dieses blöde Ding zu skaten, was damals überhaupt nicht klappte, weil es eigentlich viel zu klein ist. Wenigstens waren wir schon mal da und hatten es zuvor abgecheckt. Ich glaube, ich kenne schon ein paar Ecken, die andere Münchner vielleicht nicht kennen außerhalb der Skateboardwelt. Wir sind eben schon zuvor in irgendwelche Hinterhöfe gelaufen, die irgendwelche abgefahrenen Wandstrukturen haben oder irgendwas, weil wir dachten, dass da doch ein Spot kommen könnte. Klar hilft das einem weiter.
Es ist ja schon seit Jahren so, dass nicht mehr nur der härteste Trick in ein Heft kommt, sondern noch mehr Faktoren eine Rolle spielen: Perspektive und die Ausdruckskraft des Bildes an sich. Wie siehst du diese Entwicklung? Ich finde das eine super spannende Entwicklung. Damals, als ich angefangen habe, ging es eher darum, dass das Bild scharf ist und der Trick krass aussieht. Dadurch, dass ich irgendwie andere Einflüsse hatte und mich für die Tricks nur so nebenbei interessierte, habe ich schon immer versucht, mit meinen Fotos eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte jetzt kein Stück behaupten, dass ich da ein Vorreiter war, aber so habe ich das für mich gelernt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ganz viele Fotografen das auch so sehen und versuchen, die Geschichten hinter Skateboardfotos zu erzählen. Ich finde das cool, weil dadurch noch einmal eine völlig neue Perspektive entsteht. Nicht jeder fotografiert den Backtail von unten-links, sondern es entstehen ganz andere Möglichkeiten, da noch einmal draufzugucken. Mittlerweile sind die Skater ja eher klein im Bild und eigentlich geht es um die Taube, die im Vordergrund fliegt oder so. Ich finde das total geil, weil ich mir solche Skateboardfotos viel lieber anschaue, als immer wieder dasselbe Fisheye-Foto zu sehen. Der Nachteil daran ist leider, dass ich dadurch nicht mehr so leicht durchkomme mit meiner Art zu fotografieren. Man muss sich eben weiterentwickeln. Wenn ich immer noch so fotografieren würde, wie bei meinen ersten Skatefotos, dann wären die ja total langweilig. Alle machen das ja jetzt so. Gerade gehe ich wieder komplett zurück in die 90er und ballere mit einem Blitz direkt von der Kamera aus, um verschwommene Fisheye-Bilder zu erzeugen, weil mich das gerade interessiert. Aber Skatefotografie lebt ja von diesem Prozess. Sieht man zu lange eine Bildsprache, wird es langweilig.
Wir hörten auf einmal ein übertriebenes Anpush Geräusch und plötzlich flog dieser Typ neben uns die Treppen runter.



Du machst ja mittlerweile viele Jobs. Fehlt dir bei den ganzen Corporate Vorgaben die Freiheit oder bist du ganz froh über einen Leitfaden? In diese Corporate Schiene wächst man einfach rein. Ich habe ja Fotodesign studiert und währenddessen ganz viel assistiert. Klar ist das oft nicht das Geilste, aber ich muss halt auch meine Rechnungen bezahlen oder habe Bock mal was essen zu gehen (lacht!). Daher habe ich auch nichts dagegen, hin und wieder eher werbemäßige Hochglanzfotos zu machen. Die muss ich ja niemandem zeigen. Solche „Dienstleistungsfotos“ gehören irgendwie auch dazu. Ich habe allerdings für mich entschieden, Events komplett abzulehnen. Da fühle ich mich als Fotograf einfach nicht wohl. Daher möchte ich das nicht machen. Wenn der Job cool ist, der Output aber dann scheiße aussieht, dann ist das halt so, aber das zeige ich dann niemandem. Ich sehe das dann einfach als Job. Am Anfang war ich da sehr wählerisch und dachte, dass ich nur analog fotografieren möchte. Davon muss man sich aber als Fotograf irgendwann freimachen. Es funktioniert eben nicht nur mit schönen Geschichten. Man muss manchmal auch Jobs annehmen, die man braucht, um die nächste Miete zu bezahlen.
Zurück zur Skate-Fotografie: Musstest du dir eigentlich deinen Status und dein Recht, Bilder so zu komponieren, wie du es schön findest, erkämpfen? Viele Skater haben ja spezielle Vorstellungen von ihren Fotos. Ich bin da eigentlich ganz umgänglich. Wenn jemand seinen Trick aus einer speziellen Perspektive haben möchte, werde ich mich bestimmt nicht dagegen sperren. Dann versuche ich auch, aus dieser Perspektive ein cooles Bild zu machen oder zumindest Raum für Kritik zu geben. Ich finde, gerade wenn man einen Skater fotografiert, dann lebt das ja von der Symbiose zwischen Skater und Fotograf. Es bringt nichts, wenn der Fotograf dem Skater sagen möchte, wie es läuft. Je glücklicher der Skater mit seinem Foto ist, umso geiler ist das doch für beide. Er (oder sie) hat Bock drauf, den Trick geil zu machen und ich habe Bock darauf, ein cooles Bild zu haben. Auch wenn ich mir davor das Bild anders vorgestellt habe, dann ist das auch ok, meine Vorstellung einmal nicht durchzusetzen. Ich bin da offen für Vorschläge. Wenn Leute mitdenken und Bock haben, freue ich mich voll.
Große Projekte oder kleine Jobs, was ist dir persönlich lieber? Dadurch, dass ich meistens Magazin-Jobs mache, erübrigt sich die Frage eigentlich für mich, denn das sind fast immer kleine Sachen. Ein Porträt zu schießen oder Jobs zu machen, die nur ein paar Stunden dauern, ist mein tägliches Brot. Heute Mittag habe ich irgendwelche Schulkinder fotografiert, heute Abend mache ich noch ein Porträt von einer Drag-Queen. Ich finde es total lustig, innerhalb so kurzer Zeit in völlig verschiedene Welten einzutauchen. Tatsächlich würde ich aber auch gerne mehr Projekte machen, an denen ich ein paar Wochen arbeiten kann. Langzeitreportagen, zum Beispiel, sind mega spannend, weil am Schluss ein ganz anderer und viel umfangreicherer Output dabei herauskommt. Du hast am Ende viel mehr Kontrolle darüber, was du zeigst. Bei meinen aktuellen Jobs bin ich meistens auf die Lichtstimmung angewiesen, die eben zu diesem Termin gerade herrscht. Wenn zu der Uhrzeit gerade die Mittagssonne ist, kann ich nichts dafür und muss damit dealen. Langzeitgeschichten erlauben einem, den Ort, den man fotografieren möchte, auch zwei oder dreimal zu verschiedenen Tageszeiten zu besuchen, bis man den perfekten Moment erwischt hat. Von daher finde ich, dass beides seinen Reiz hat. Zum einen die unterschiedlichen Mikrokosmen, die man in kurzer Zeit erleben kann und zum anderen die Möglichkeit sich intensiv mit einem speziellen Thema auseinander zu setzen.
Wenigstens waren wir schon mal da und hatten es zuvor abgecheckt


Als Fotograf bist du ja eigentlich immer nah an den Menschen dran, mit denen du arbeitest. Wie gehst du mit den Leuten um? Nicht jeder wird viel Lust haben, fotografiert zu werden. Ich versuche einfach, so nett wie möglich zu sein. Außerdem ist es wichtig, im Vorfeld viel mit den Leuten zu sprechen. Das Ziel bei Porträts ist es, die Personen so wenig wie möglich von der Kamera merken zu lassen. Das ist auch ein Grund, weshalb ich bei solchen Bildern nur ganz selten Licht aufbaue. Dadurch bleiben die Fotos unmittelbar. Dann verhalten sich die Leute nämlich noch am ehesten so, wie sie auch in ihrem Alltag sind. Oft unterhalte ich mich mit den Protagonisten und nehme die Kamera nur ab und zu mal in die Hand, um ein Bild zu schießen. Sollen Leute intensiver porträtiert werden, setze ich mich auch gerne im Vorfeld auf einen Kaffee mit ihnen zusammen. Ohne zu wissen, was das für eine Person ist, kann ich kein vernünftiges Porträt von ihr machen. Schauspieler sind da ein gutes Beispiel. Besonders bei Kreativen spielt es eine Rolle was ihre Talente oder Hobbies sind. Weiß man das, kann man diese Dinge dann auch wieder in das Foto mit einfließen lassen. Ich versuche, die Personen kennen zu lernen und dabei sie selbst sein zu lassen.
Nehmen wir das Thema mal von einer anderen Seite. Wie sieht das dann mit dem Fotografieren am Skatespot aus? Bist du schnell genervt, wenn jemand seine Tricks nicht steht? Meistens hat man ja eine Perspektive, die man cool findet. Dauert es dann mal länger, bis der Trick gestanden ist, warte ich meistens, bis ein Versuch gestanden hätte sein können. Erst dann fange ich an, die Perspektive zu wechseln, eine andere Linse auszuprobieren oder auf dem Dach rumzulaufen. Hauptsache, der Safe-Shot ist schon da. Danach kann man ohne Druck spielen und experimentieren. Eigentlich hat man mehr Möglichkeiten, ein Bild zu machen, wenn jemand etwas länger braucht, um den Trick zu stehen. Bei richtig guten Skatern ist der Druck halt viel höher, weil du im Schnitt nur ein paar Versuche hast, bis sie den Trick stehen. Bei einem Kilian Heuberger, der die krassesten Sachen in zwei Versuchen gemacht hat, wäre ich ungerne der Fotograf gewesen.
Wenn du am Abend einen Job hast, wann fängt dann dein Kopf das Arbeiten an? Bei dem Job heute Abend, geht es um ein Porträt aus einer Serie von 20 Stück. Da habe ich also schon einiges an Vorarbeit geleistet, denn die Person heute ist die 14te. Der Style sollte aber bei allen Bildern gleich sein. Von daher ist durch die äußeren Rahmenbedingungen schon relativ viel vorgegeben. Viel nachdenken muss ich deshalb in diesem Fall nicht (lacht!). Viel mehr Sorgen macht mir der Punkt, dass ich noch nie mit einer Drag-Queen zu tun hatte und von daher noch nicht einmal weiß, wie ich sie ansprechen soll, ob als sie oder er (lacht!). Prinzipiell lässt sich aber sagen, dass bei mir der kreative Prozess eines Bildes schon relativ lange vor dem eigentlichen Bild startet. Die große Frage ist jedes Mal, wenn ich meinen Rucksack packe, was ich mitnehmen und manchmal auch, wie ich selber dort hingehen soll. Kann ich wie ein Skateboarder aussehen oder muss ich für den Termin vielleicht doch ein Hemd anziehen, um überhaupt ernstgenommen zu werden? Solche Fragen muss ich mir leider stellen. Das eigentliche Fotografieren geschieht für mich aber dann tatsächlich erst vor Ort. Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken im Vorfeld darüber, sondern gehe hin und überlege erst dann, wie genau ich meine Ideen umsetzen möchte. Die Erfahrung hat mir nämlich gezeigt, dass es vor Ort eh nie so ist, wie man sich das überlegt hat und man daher immer enttäuscht wird. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich erst an der Location schaue, was genau ich fotografiere und wie das funktionieren könnte. Schlussendlich muss ich ja mit den Gegebenheiten so oder so klarkommen.
Damals, als ich angefangen habe, ging es eher darum, dass das Bild scharf ist und der Trick krass aussieht.



Gibt es auch Kunden, die trotz Absprache nicht mit einem Bild zufrieden sind? Wie regelt man das dann? Das Bild ist ja schon im Kasten. Diesen Fall hatte ich tatsächlich erst einmal. Das war ein Projekt für Bauingenieure. Ich sollte Bilder von verschiedenen ihrer Bauprojekte machen und die Rahmenbedingungen waren einfach nicht gut. Es hat geregnet, die Auftraggeber hatten aber nur an dem einen Tag Zeit und eines der Gebäude war sogar noch eingerüstet. Insgesamt ging es um vier Häuser im Münchner Stadtgebiet. Am Ende fand ich die Bilder selber richtig scheiße. Ich habe meine Arbeit zwar abgegeben, dafür aber nie eine Rechnung geschrieben, weil ich mir dachte, dass die mit diesen Bildern eh nichts anfangen könnten. Was soll der Mist dann? „Lass einfach gut sein!“, dachte ich mir. Wenn ich das jetzt noch abgerechnet hätte, wäre es für alle Beteiligten schrecklich unangenehm gewesen. Ich habe es einfach verkackt und dazu stehe ich auch. Es ist aber auf jeden Fall immer die Erwartungshaltung der Kunden zu spüren, was dann Druck aufbaut. Mittlerweile bin ich aber relativ entspannt, was das angeht, denn meistens klappt ja alles.
Hast du dich eigentlich intensiv mit Bildrechten auseinandergesetzt? Man kann ja nicht einfach auf die Straße gehen und alles fotografieren. Das muss man zwangsläufig, vor allem in München. Da gibt es einige Gebäude, die bei kommerziellen Arbeiten nicht im Hintergrund erscheinen dürfen. Dazu zählen, zum Beispiel, die Pinakotheken, die richtig Stress machen können, wenn die ohne Einwilligung als Hintergrund für Werbung verwendet werden. Irgendwann weiß man aber, an welchen Orten in der Stadt die Sache kritisch ist. Zu viele Gedanken darf man sich aber nicht machen, da man ansonsten vielleicht zu unentspannt ist und keinen Spaß mehr hat (lacht!).
Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Wie schaffst du dir einen Ausgleich? Ganz stumpf: Durch Skaten. Sobald ich aufs Brett steige, denke ich nicht an Arbeit, sondern kann meinen Kopf völlig ausschalten. Hin und wieder entsteht dann trotzdem mal ein Bild, aber meist eher zufällig. Da ich bei solchen Sessions nicht als Fotograf dabei bin, sondern selber als Skater, funktioniert das als Ausgleich mega gut bei mir. Ansonsten versuche ich immer, Fotoprojekte zu machen, sobald ich unterwegs bin. Wenn ich mit meiner Freundin im Urlaub war, haben wir versucht, daraus eine coole Bildstrecke zu machen. Auch diese New York Geschichte war ein privater Aufenthalt, den ich dann eben auch bebildert habe. Der Druck ist in dem Moment nicht da und wenn dabei etwas Gutes rauskommt, ist das natürlich umso geiler.
Du hast ja bereits im dritten Semester einen Job für Mercedes gemacht. Wie kam es denn dazu? Das klappte über meinen Photoshop-Dozenten an der Uni. Witzigerweise bin ich richtig schlecht in Photoshop, aber trotzdem mochten wir uns. Auf jeden Fall hat er nebenbei noch für eine Agentur gearbeitet, die in Stuttgart sitzt und viel für Mercedes macht. Denen ist damals ein Fotograf für ein relativ großes Shooting auf Mallorca abgesprungen. Da kam mein Dozent auf mich zu und meinte, dass ich das schon übernehmen könnte, auf Grundlage dessen, was er an Arbeiten von mir kannte. Klar war ich nervös, sagte aber schließlich zu. Ein paar Tage später stand ich dann auf einem Berg in Mallorca mit zehn Leuten hinter mir und war Fotograf an so einem riesigen Set. Bis dahin war ich selber noch nie an so einem großen Set, musste aber auf einmal Leute delegieren und kam mir ein bisschen wie ein Hochstapler vor (lacht!). Aber es hat alles ganz gut hingehauen. Die Bilder sind sogar auf der Startseite von Mercedes-Benz.com gelandet. Ohne Scheiß, das war ziemlich crazy (lacht!).
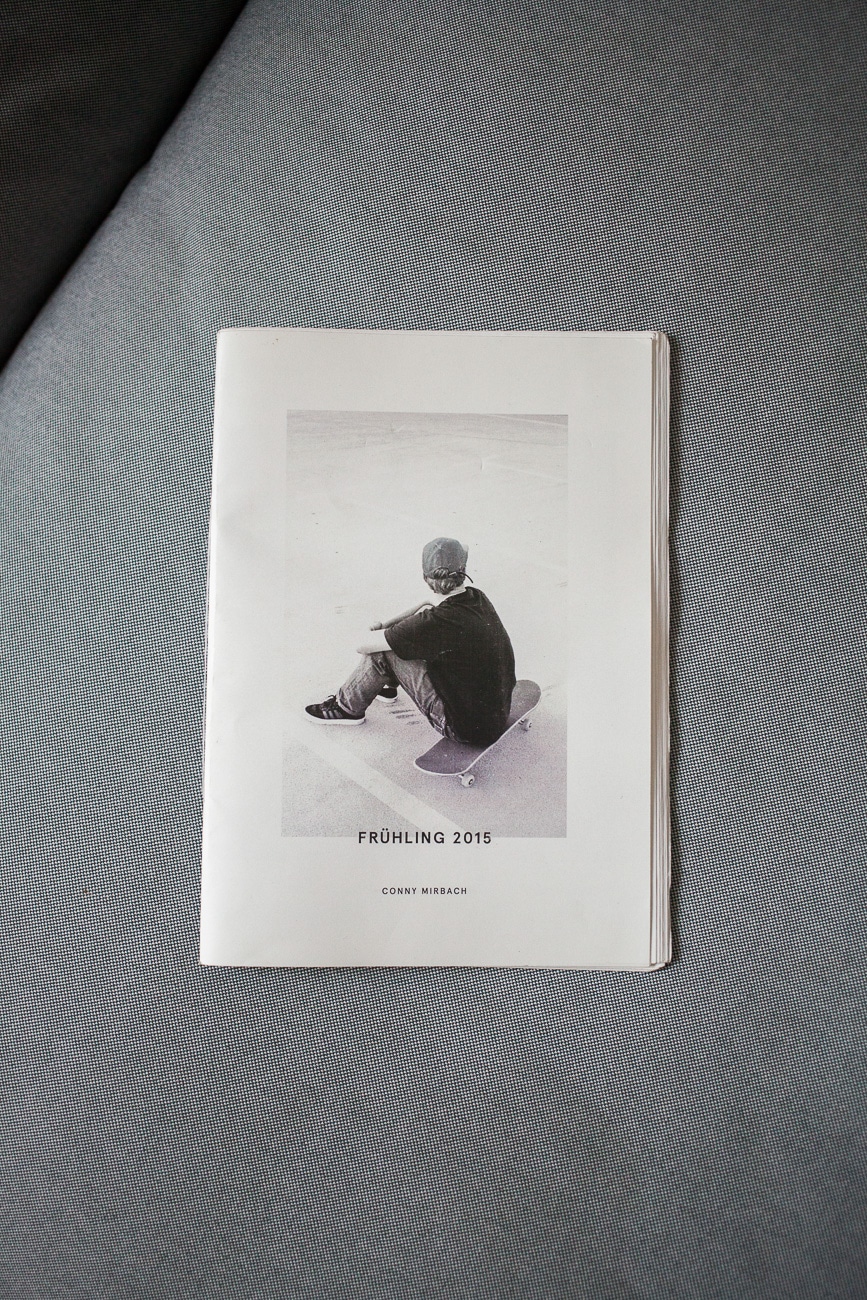


Freche Frage: Willst du kein Photoshop-Profi sein oder fehlt dir einfach das Verständnis dafür? Ich denke, das liegt daran, dass ich bei meinen Jobs, meistens nicht darauf angewiesen bin, viel an den Bildern zu verändern. Bei Werbejobs sieht das anders aus. Meistens gibt es da eine Person, die nur für die Retusche zuständig ist. Mir ist wichtig, dass ein Bild schon vor der Bearbeitung gut ist. Außerdem finde ich übertrieben mit Photoshop bearbeitete Bilder mit zu glatter Haut nicht schön. Daher ist das Programm für mich auch nicht wahnsinnig relevant.
Merkst du, dass der technische Fortschritt bei Handykameras oder dergleichen dir deinen Job schwieriger macht? Jeder ist für Insta und Co. ja mittlerweile Hobbyfotograf. Klar ärgere ich mich manchmal, dass so ein Handyfoto, welches nach 10 Sekunden Mini-Retusche in der Insta-Story landet, auf dem kleinen Screen genauso gut aussieht, wie ein professionelles Bild, aber soo viel gemerkt habe ich noch nicht Allerdings habe ich schon bei meinem eigenen Equipment Seitenhiebe bekommen. Als ich einmal Anwälte einer Kanzlei fotografierte, fragte mich einer, ob das denn etwa noch die alte Canon sei. Damit wollte er mir von oben herab mitteilen, dass er schon das neue Modell zuhause hatte, ich aber noch nicht. Dabei ist mir dieses ganze Kamera-Generde ziemlich egal. Für mich zählt, dass eine Kamera gut in der Hand liegt und ein scharfes Bild macht. Das kriegt sogar eine Einwegkamera hin. Von daher spielt das für mich keine große Rolle. Klar muss man am Ball bleiben und sich damit beschäftigen, es hat für mich aber keine Priorität. (lacht!).
Hast du ein Ideal, wie ein gutes Foto aussehen muss? Nein, das variiert allein schon durch den Ort, an dem du das Bild anschaust. Bei Instagram funktionieren ganz andere Fotos als in einem Magazin. Am Handy kann das Bild einer Ananas mega geil aussehen, gedruckt könnte das aber zu wenig sein. Je größer der Bildschirm, desto vielschichtiger darf ein Bild in meinen Augen auch sein. Pauschal sagen kann man das also nicht. Das ist für mich mega, mega subjektiv.
Vielen Dank für das Interview. Jetzt wäre noch Platz für Danksagungen… Der erste Dank gilt meinen Eltern, die mir Rückhalt gegeben haben, als ich mein Studium abgebrochen habe, um Fotograf zu werden. Dann vielen Dank an alle, die mich in meinem kreativen Prozess beeinflusst haben, an alle, mit denen ich schon mal als Fotograf zusammengearbeitet habe (und die hoffentlich happy waren), an Salut Skateboards, Soohotrightnow und Manu und Hias von Vans.